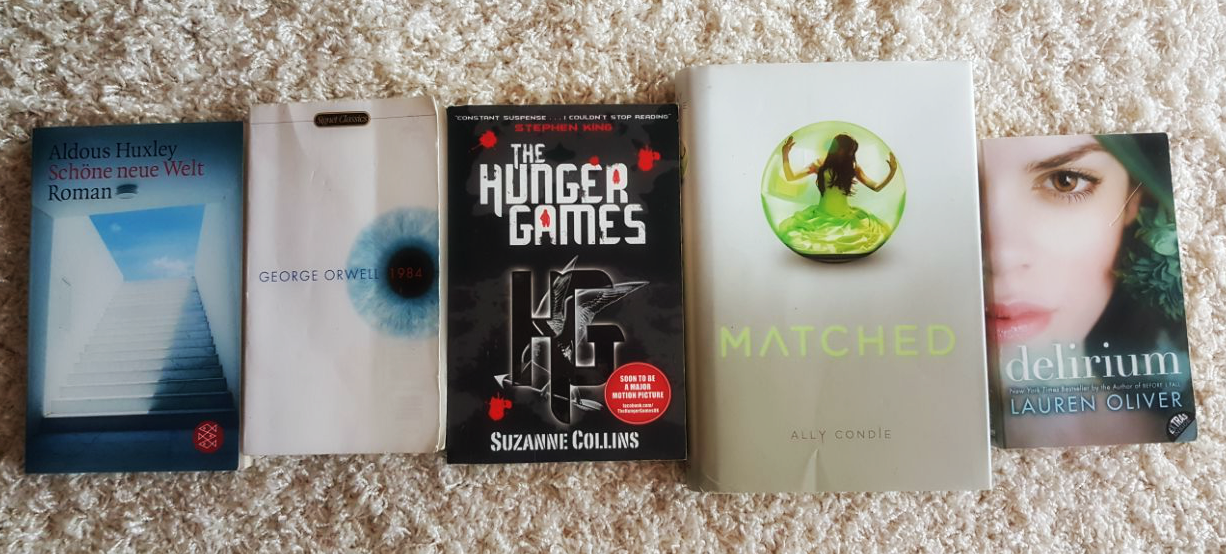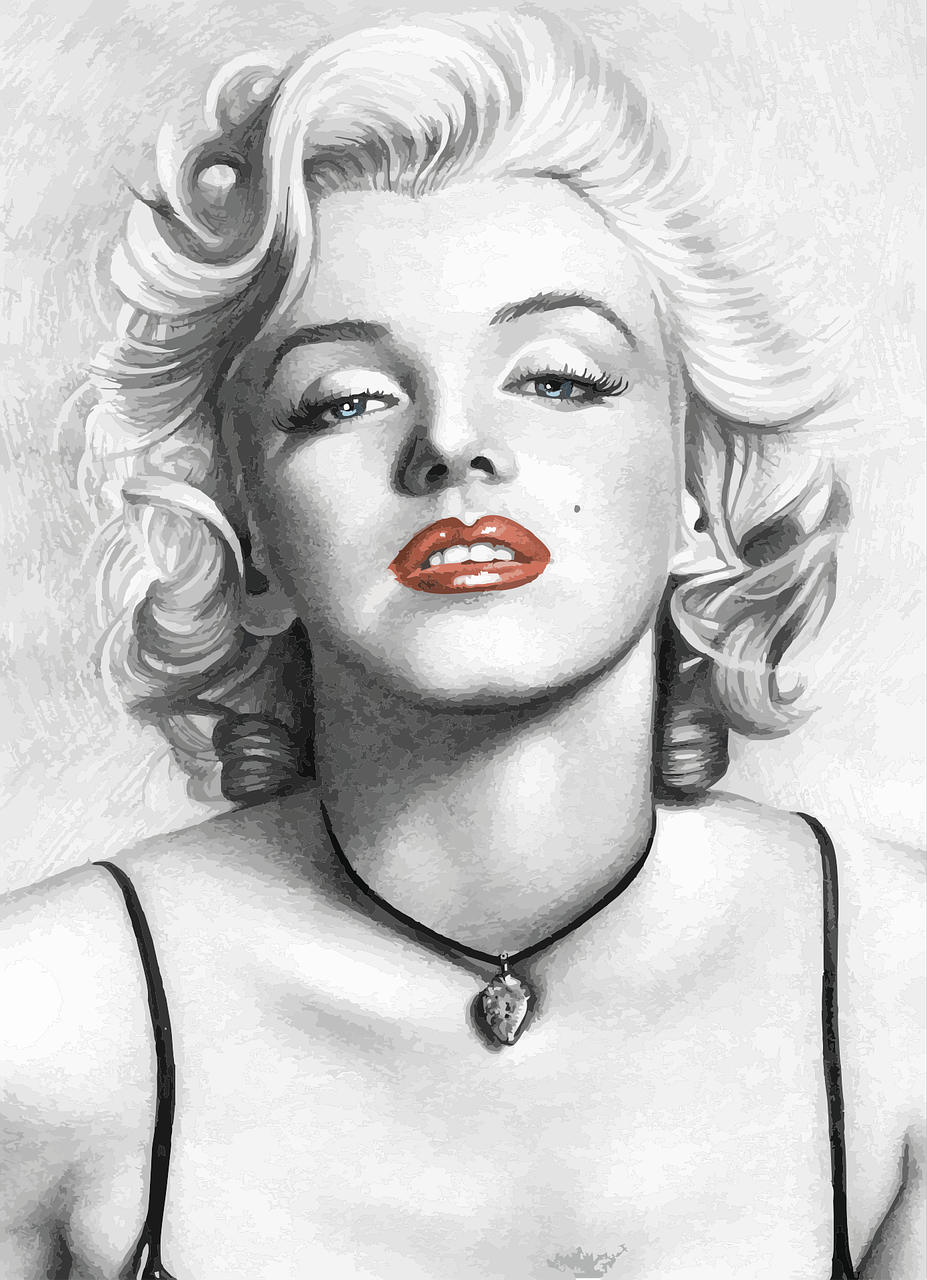Der Supermarkt ist unser Garten: Zwischen 35 verschiedenen Sorten Tomaten zu wählen ist doch viel einfacher, als die Dinger selbst anzupflanzen. Warum sich trotzdem manche Menschen die Mühe machen, in der Stadt zu gärtnern und ihre eigenen Lebensmittel anzubauen. Eine Reportage.
Geneviève Zuber beugt sich über das Beet. Zwischen der braunen, krümeligen Erde lugen hier und da grüne Pflänzchen hervor, die sich dem strahlenden Sonnenschein entgegenrecken. Der Gemeinschaftsgarten der Gruppe „Essbares Rieselfeld“ liegt in einem kleinen Park zwischen Wohnblocks und Betonbauten, keine 500 Meter von der Straßenbahnhaltestelle entfernt. Vor fast fünf Jahren fanden sich nach einer Vorführung des Films „Voices of Transition“ zehn Entschlossene zusammen. Die Geburtsstunde des „Essbaren Rieselfelds“. Zuber war von Anfang an mit dabei. Der Dokumentarfilm Voices of Transition vom Tübinger Regisseur Nils Aguilar zeigt, wie sich die Welt unter dem Eindruck der drohenden Öl- und anderen Krisen verändert und verändern sollte. Urban Gardening zum Anbau von Lebensmitteln ist ein Teil davon.
Der Garten als soziales Netzwerk
„Der Garten ist wie eine Art soziales Netzwerk“, erzählt Geneviève Zuber. „Viele Leute haben sich hier kennengelernt und unternehmen auch über den Garten hinaus Dinge zusammen.“ Der Park im Freiburger Stadtteil Rieselfeld scheint die perfekte Kulisse für Urban Gardening zu sein. Trotz dem der Garten zentral liegt, beherrschen hier Vogelgezwitscher und summende Bienen statt Autolärm die Geräuschkulisse.
Urbaner Gartenbau liegt mehr und mehr im Trend. In vielen Groß- und Kleinstädten entstehen Gemeinschaftsgärten. Vom subversiven Guerilla-Gardening bis zum altbekannten Schrebergarten reicht die Bandbreite des Urban Gardening. Ein Teil dieser Bewegung sind die sogenannten „Transition Towns“. 2006 ernannten die Einwohner von Totnes im südlichen England ihr 8000-Seelen-Örtchen zur ersten Transition Town. Die Idee: Die ganze Stadt sollte unabhängig vom Erdöl werden. Ein wichtiger Teil der Aktivitäten in Totnes bestand aus urbanem Gartenbau zum Beispiel Nussbäume und Gemüse auf öffentlichen Plätzen. Inzwischen führen die Gründer über 800 verschiedene Transition Towns weltweit auf ihrer Website auf. Auch Freiburg ist (unter anderem durch das Engagement des Essbaren Rieselfelds) eine von ihnen.
Urban Gardening als Anti-Globalisierungshaltung?
Zu den Zielen der Transition Towns gehört auch eine relokalisierte Wirtschaft. Das bedeutet beispielsweise Unabhängigkeit von Exporten und wirtschaftlichen Protektionismus, also das Bevorteilen der heimischen Wirtschaft gegenüber von ausländischen. Tatsächlich ist diese Idee einigermaßen revolutionär, wenn man sie vor dem Hintergrund der fortschreitenden Globalisierung betrachtet. Entsteht Urban Gardening also durch eine Anti-Globalisierungshaltung? Geneviève Zuber nennt es „Engagement für das eigene Umfeld und sich selbst“. Sie ergänzt „Wir unterstützen das Bewusstsein für die Frage: Wo kommen das Lebensmittel her?“
Diese Frage beschäftigt auch Juan, der heute mit seinen zwei Kindern Carla und Yago zum ersten Mal da ist. „Meine Kinder sollen lernen, woher ihr Essen kommt“, betont der Spanier mit Schiebermütze und Dreitagebart. Er ist erst vor Kurzem mit seiner Familie nach Deutschland gekommen. In den Gemeinschaftsgarten im Rieselfeld kommen viele junge Familien mit Kindern.
Die moderne Lebensweise isoliert den Menschen
„Wir sind noch davon entfernt, Selbstversorger zu sein“, so Krishna Kempff, ebenfalls Gründungsmitglied des Essbaren Rieselfelds. „Das wäre aber möglich“, schiebt sie hinterher – würde sich aber nur bei stärkerem materiellen Druck verwirklichen. „Als beispielsweise in Detroit die Autoindustrie zu Bruch ging haben die Menschen angefangen, ihr eigenes Gemüse anzubauen, aus einem Überlebensimpuls heraus. Das ist bei uns natürlich nicht der Fall, weil wir nach wie vor im Überfluss leben.“
„Generell isoliert unsere moderne Lebensweise die Menschen. So ein Garten bietet die Gelegenheit, gemeinsam etwas anzupflanzen, Feste zu feiern und sich auszutauschen.“, meint Krishna Kempff. Ein Bild, dass so gar nicht in das Klischee der anonymen Großstadt passen will, wo niemand mehr seine Nachbarn kennt. Für die 64-Jährige in Crocs und türkisfarbenem Oberteil geht es im Urban Gardening auch ums Teilen. Der Garten ist nicht eingezäunt, jeder der vorbeikommt darf auch ernten. Ein anderer Aspekt, der im Gespräch von Kempff und Zuber immer wieder betont wird: Das soziale Miteinander. „Man trifft seine Nachbarn mal in einem anderen Kontext“, so Krishna Kempff. Das hier keine Fremden nebeneinander gärtnern merkt man sofort. Die Leute kennen sich alle mit Namen und sie tauschen gegenseitig Werkzeug aus. Es entsteht eine Gemeinschaft und – ganz nebenbei – wachsen Kartoffeln, Lauch, Tomaten und Bohnen.